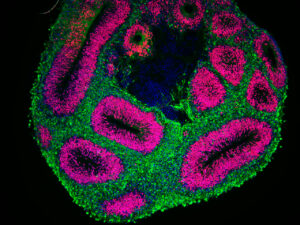Campus Berlin Buch: Projekt „RENEWAC“ für die Berliner „Innovationsförderung Tiefengeothermie“ ausgewählt
27.07.2023 / Die Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt hat im Rahmen des „Innovationsfonds Tiefe Geothermie des Landes Berlin“ das Projekt „RENEWAC“ in Berlin-Buch als einen von drei ermittelten Bohr-Standorten in Berlin benannt. Grundlage war die Evaluierung der geologischen Rahmenbedingungen, die Eignung des energetischen Konzepts für eine tiefengeothermische Nutzung und der zu erwartende Erkenntnisgewinn für das Land Berlin. Hintergrund ist der Senatsbeschluss vom 20.07.2021 zur Umsetzung neuer Perspektiven der tiefen Geothermie als valider Teil der „klimaneutralen Wärmeversorgung Berlin 2035“
Dazu Dr. Christina Quensel, Geschäftsführerin der Campus Berlin Buch GmbH: „Berlin-Buch ist einer der 11 Zukunftsorte Berlins und steht für die Medizin der Zukunft. Ein Ort, an dem lebenswissenschaftliche Forschung, Gesundheitswirtschaft und –versorgung eng zusammenarbeiten und neue Diagnostika und Therapien entwickeln. Der Betrieb von Laboren und Hightech-Infrastrukturen für Forschung und Entwicklung benötigt viel Energie. Max Delbrück Center (MDC), Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, Charité und CBB arbeiten bei der Optimierung des Gebäudebetriebs durch Digitalisierung und Einsatz modernster Technologien in der Gebäudetechnik auch eng mit dem Hermann-Rietschel-Institut der Technische Universität Berlin zusammen. Energiemanagement und die Erschließung alternativer Energiequellen spielen dabei eine wichtige Rolle. Daher hat die CBB als Vertreter des Campus gemeinsam mit dem Geoforschungszentrum das Projekt „RENEWAC“ begonnen. Mit dem Zuschlag einer Erkundungsbohrung kann dieses Projekt nun mit echten Daten validiert werden“.
Mit dem Ergebnis der Evaluierung gelingt es der Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft erstmals, die gesellschaftlich herausragende Rolle der Quartiere bei der Wärmewende und den Einbezug von Mieter:innen mit einem näher rückenden Nullemissions-Ziel zu verknüpfen. Die von der Helmholtz-Gemeinschaft prognostizierte bundesweit mögliche Erschließung von zusätzlichen 300 Terrawattstunden (TWh) Nullemissions-Wärmenergie aus tiefer Geothermie erhält ein konkretes Umsetzungsziel in Gewerbe- und Wohnquartieren im Stadtteil Buch. Die Mittlerrolle der kommunalen und genossenschaftlichen Vermieter:innen bei der Gestaltung des Klimawandels wird offenbar, da die Erschließung dieser Einsparoption die Basis für die Einsparung von Heizenergie durch eine bisher noch unausgeschöpfte Quelle darstellt.
Zwei weitere Standorte wurden gleichzeitig benannt: Das Projekt am ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel und das Fernheizwerk Neukölln AG. Dr. Manja Schreiner, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt: „Fast die Hälfte des gesamten Endenergiebedarfs entfällt im Land Berlin auf den Raumwärme- und Warmwasserbedarf des Gebäudesektors. Bereitgestellt wird die Wärme bislang zu über 90 Prozent durch fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Erdgas. Diesen Anteil wollen wir dringend reduzieren und bei der Wärmeversorgung neue Wege gehen. Damit Berlin bis spätestens 2045 klimaneutral werden kann, kommt einer zukünftigen Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energiequellen eine zentrale Bedeutung zu. In den aktuellen Analysen zur Wärmewende in Berlin stellt Wärme aus der tiefen Geothermie einen wichtigen Baustein dar. Mit den Bohrungen an den drei Pilotstandorten möchten wir dieser Technologie den dringend benötigten Impuls geben.“
Die Projektinitiative ging von einem Kernteam der Campus Berlin-Buch GmbH (CBB), des Helmholtz-Zentrums Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ und des Vereins „green with IT“ aus. Zunächst wurde ein Modellvorhaben für Wärmenetzsysteme 4.0 mit dem Titel „Regenerativer Netzausbau Wärme Campus Berlin-Buch“ (RENEWAC) im Programm „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in der Stufe I beantragt und bewilligt. Die Stufe I sieht die Erstellung einer Machbarkeitsstudie vor. Damit war das Projekt soweit vorbereitet, dass durch eine weitere Förderung der nachfolgenden Bohraktivitäten die notwendige Aussicht auf eine nachhaltige, langfristig berechenbare und dauerhaft installierte Nullemissions-Entwicklung durch Ersatz der vorhandenen fossilen Primärenergie-Einträge gegeben war.
Für die technische Umsetzung zeichnet Prof. Dr. Ing Ingo Sass vom GFZ Potsdam verantwortlich. Sass empfiehlt folgenden Handlungsrahmen dazu: „Die Politik sollte klare Ausbauziele formulieren und diese regulatorisch untersetzen. Kurzfristig benötigt werden Instrumente zur Risikominderung; insbesondere finanztechnische Werkzeuge, geophysikalische Untersuchungen in Ballungsräumen und ein Explorationsbohrprogramm. Sinnvoll ist die Förderung von 10 – Jahres-Schlüsseltechnologien; z. B. Bohr- / Reservoirverfahren (Multilaterale / EGS), Bohrlochpumpen, Hochtemperatur-Wärmepumpen, Entwicklung von Großwärmespeichern und die sektorübergreifende Systemintegration. Hier sollte die Aktivierung des hohen Wertschöpfungs- und Arbeitsmarktpotenzials von 5-10 Personen je MW installierter Leistung durch bildungspolitische und wirtschaftsfördernde Maßnahmen fokussiert werden. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit mit proaktiver politischer Begleitung ist wichtig; Kommunen sollen in den Mittelpunkt der Kommunikation mit partizipativen Möglichkeiten gestellt werden“.
Als Antragsteller hatte sich die CBB frühzeitig entschieden, die regionalen Partner aus der angrenzenden Wohnungswirtschaft und der Wärmeversorgung einzubeziehen. Dr. Quensel begründet dies wie folgt: „Der Stadtteil Berlin-Buch verfügt über die Besonderheit eines lokalen Fernwärmenetzes mit modernem Heizkraftwerk. Der Campus mit seinen Forschungseinrichtungen, die umliegenden Krankenhausareale und Wohngebiete werden zum größten Teil mit Fernwärme beheizt. Daher lag es nahe, mit dem größten Wohnungsanbieter in Buch und vor allem mit dem Versorger gemeinsame Lösungsstrategien zu entwickeln. Letztendlich sollen alle Player in Berlin-Buch einbezogen werden. Dazu bestehen mit der Erarbeitung des Energetischen Quartierskonzepts Berlin-Buch 2017-2018 unter Federführung des Bezirks Pankow beste Voraussetzungen. “
Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE hält zahlreiche Wohneinheiten rund um den Campus Berlin Buch im Bestand, Dazu Matthias Schmitz-Peiffer, Geschäftsführer der HOWOGE Wärme GmbH: „Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft hat das Ziel, spätestens bis 2045 klimaneutral zu sein. Bezahlbare Wärme mit keinen oder sehr geringen CO2-Emissionen ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu diesem Ziel. Gemeinsam mit den anderen Projektteilnehmern unterstützen wir daher das Projekt tiefe Geothermie in Buch.“
Auch der regionale Fernwärme-Versorger sieht für die Dekarbonisierung des Wärmenetzes in Berlin Potenziale in der Tiefengeothermie. Christian Feuerherd, Vorstandsvorsitzender der Vattenfall Wärme Berlin AG erläutert dazu: „Bis 2040 wollen wir unsere Wärmeerzeugung in Berlin klimaneutral gestalten. Die Forschung und Entwicklung zur Tiefengeothermie ist hierbei ein wichtiger Baustein, um erneuerbare Abwärmequellen für die Fernwärme nutzbar zu machen. Für dieses Vorhaben stellen wir als Kooperationspartner die benötigten Flächen für die Explorationsbohrung auf unserem Kraftwerksgelände in Buch zur Verfügung. Die Verankerung von Projekten wie diesem in das Sondervermögen hilft, die Wärmewende gemeinschaftlich und sozial weiter voranzutreiben.“
Jörg Lorenz vom Verein „green with IT“ freut sich über diese dynamische Entwicklung: „Schon seit vielen Jahren begleiten wir den Campus Berlin Buch bei der konsequenten Umsetzung einer Nullemissions-Strategie. Der Campus ist Teilnehmer des national und international mehrfach ausgezeichneten Vorprojektes ‚WohnZukunft‘, welches schon von Beginn an Kennzahlen und CO2-Senkungspotenziale aus Gewerbe- und Wohnungswirtschaft gemeinsam erforscht und mit pilotierten Ergebnissen untersetzt hatte. Außerdem wurde der Campus vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz als „ausgezeichnetes Reallabor“ gewürdigt. Tiefengeothermie ist eine regionale Quelle, die unsere Abhängigkeit vom Import fossiler Energie bedeutend reduzieren kann und das Potenzial zur Kostensenkung hat. Umwelt, Vermieter und Mieter profitieren gleichermaßen. Eine solche win-win-win-Situation hatten wir uns schon lange gewünscht. Aus diesem Grund etablieren wir aktuell ein neues Netzwerk „CO2zero“ – speziell für die erweiterte Umsetzung genau dieser Ziele in großen Projekten“.
Quelle: Campus Berlin-Buch/News